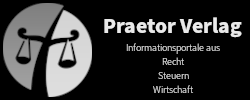Ausweisung eines hier geborenen türkischen Drogenhändlers
Ein türkischer Drogenhändler darf auch dann aus Deutschland ausgewiesen werden, wenn er den erhöhten Schutz nach den Regelungen des Assoziationsrechts EU-Türkei genießt. Allerdings muss bei ihm eine konkrete Wiederholungsgefahr bestehen. Diese entfällt nicht allein deshalb, weil die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt wurde.
Der jetzt verkündeten Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig lag der Fall eines 31-jährigen türkischen Staatsangehörigen zugrunde, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. Er schloss hier die Hauptschule und eine Ausbildung als Verpackungsmittelmechaniker ab. Spätestens seit Mitte des Jahres 2002 handelte der Kläger mit Drogen. Seit April 2004 wurde er aufgrund eines Haftbefehls gesucht; Mitte 2005 wurde er in den Niederlanden verhaftet und an die deutschen Behörden überstellt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Kläger als Teil einer Bande mit mindestens zwei Tonnen Marihuana und mehreren Kilogramm Kokain und Ecstasy-Tabletten gehandelt. Das Landgericht Stuttgart verurteilte ihn im November 2005 zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun Jahren. Das Regierungspräsidium Stuttgart verfügte im Oktober 2006 die Ausweisung des Klägers aus Deutschland. Der Kläger habe zwar einen nach Art. 7 des Assoziationsratsbeschlusses EWG/Türkei 1/80 – ARB 1/80 – privilegierten Aufenthaltsstatus, dürfe aber unter den Voraussetzungen des Art. 14 ARB 1/80 nach Ermessen ausgewiesen werden.
Die gegen die Ausweisung gerichtete Klage blieb sowohl vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart[1] wie auch vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim[2] ohne Erfolg. Das assoziationsrechtliche Aufenthaltsrecht des Klägers sei erloschen, so der Verwaltungsgerichtshof, weil er Anfang April 2004 aus Deutschland geflohen sei, um sich auf Dauer seiner Strafverfolgung im Bundesgebiet zu entziehen. Damit habe er seinen Aufnahmemitgliedstaat für einen nicht unerheblichen Zeitraum ohne berechtigte Gründe verlassen. Infolge der Ausreise genieße er keinen besonderen Ausweisungsschutz mehr. Die wegen der erheblichen Wiederholungsgefahr verfügte unbefristete spezialpräventive Ausweisung sei auch im Hinblick auf das Privat- und Familienleben des Klägers (Art. 8 EMRK) verhältnismäßig. Sie sei im Übrigen wegen der ganz besonderen Schwere der Straftat auch aus generalpräventiven Gründen gerechtfertigt. Hiergegen richtet sich die vom Senat zugelassene Revision des Klägers. Er vertritt die Auffassung, seine Rechte aus Art. 7 ARB 1/80 nicht verloren zu haben, weil ein solcher Verlust nicht aufgrund seiner Absicht zur Flucht bei der Ausreise eingetreten sei. Weiter rügt er, die Ausweisung sei verfahrensfehlerhaft in einem einstufigen Verwaltungsverfahren ohne Beteiligung einer unabhängigen Stelle ergangen. Eine solche Beteiligung fordere aber der Ausweisungsschutz nach dem ARB 1/80.
Und auch das Bundesverwaltungsgericht sah jetzt die Ausweisung als rechtmäßig an:
Das Bundesverwaltungsgericht entschied in Anlehnung an die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union, dass auch ein durch das Assoziationsrecht EU-Türkei privilegierter türkischer Staatsangehöriger dann ausgewiesen werden darf, wenn sein persönliches Verhalten gegenwärtig eine tatsächliche und hinreichend schwere Gefahr für ein Grundinteresse der Gesellschaft darstellt und die Maßnahme für die Wahrung dieses Interesses unerlässlich ist. Diese Voraussetzungen sind im Fall des Klägers erfüllt. Wie die Vorinstanz festgestellt hat, lassen die vom Kläger begangenen schweren Drogenstraftaten und seine Persönlichkeitsentwicklung seitdem – auch unter Berücksichtigung aller sonstigen Umstände des Einzelfalls – den Schluss auf ein zukünftig straffreies Leben nicht zu. Bei dieser Gefahrenprognose sind die Verwaltungsgerichte nicht an die Einschätzung der Strafgerichte bei deren Entscheidung über die Aussetzung des Strafrestes zur Bewährung gebunden.
Auf der Grundlage der für die tatsächliche Beurteilung maßgeblichen Sachlage im Zeitpunkt der Entscheidung des Berufungsgerichts hat der Senat die Ausländerbehörde verpflichtet, das mit der Ausweisung verbundene Einreise- und Aufenthaltsverbot auf neun Jahre zu befristen.
BVerwG 1 C 20.11 – Urteil vom 13. Dezember 2012
- VG Stuttgart, Urteil vom 12.03.2008 – 8 K 3985/06[↩]
- VGH Bad.-Württ., Urteil vom 15.04.2011 – 11 S 189/11[↩]