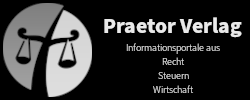Konzerninterne Inkassokosten
Eine Inkassovergütung stellt auch dann einen ersatzfähigen Verzugsschaden dar, wenn es sich bei dem von dem Gläubiger mit der Einziehung der Forderung beauftragten Inkassodienstleister um ein mit ihm im Sinne von § 15 AktG verbundenes Unternehmen handelt (sogenanntes Konzerninkasso) und die zwischen diesen beiden Gesellschaften getroffenen Vereinbarungen dazu führen, dass eine (unmittelbare) Zahlung der Vergütung durch den Gläubiger an den Inkassodienstleister im Regelfall ausscheidet.
Eine gegen diese Praxis gerichtete Musterfeststellungsklage des Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) gegen ein solches Konzernunternehmen, dessen Geschäftsgegenstand unter anderem der Erwerb von Forderungen ist, hat der Bundesgerichtshof abgewiesen.
Dieses Konzernunternehmen beauftragte mit der Einziehung ihrerseits erworbener Forderungen regelmäßig eine Schwestergesellschaft, die Inkassodienstleistungen erbringt. Nach der zwischen diesen beiden Gesellschaften getroffenen Rahmenvereinbarung macht die Inkassodienstleisterin die – bis zur erfolgreichen Einziehung beim Schuldner im Verhältnis zu dem beklagten Konzernunternehmen gestundete – Inkassovergütung als Verzugsschaden gegenüber dem jeweiligen Schuldner geltend und behält den entsprechenden Betrag ein, wenn der Schuldner die Forderung erfüllt, während andernfalls – wenn der Schuldner die Forderung nicht erfüllt – das beklagte Konzernunternehmen ihren entsprechenden Schadensersatzanspruch gegenüber dem Schuldner an die Inkassodienstleisterin an Erfüllungs statt abtritt. Die Höhe der Vergütung richtet sich dabei vereinbarungsgemäß nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). In dem Zeitraum von Februar 2020 bis einschließlich April 2021 machte die Inkassodienstleisterin im Auftrag des beklagten Konzernunternehmens gegenüber zahlreichen Verbrauchern Forderungen geltend, mit deren Erfüllung der jeweilige Schuldner bereits zuvor in Verzug geraten war. Neben der Hauptforderung verlangte diese von den Schuldnern jeweils Verzugszinsen sowie – für die Einziehungstätigkeit der Inkassodienstleisterin – die Erstattung einer Inkassovergütung in Höhe einer 1,3-fachen Gebühr nach Nr. 2300 des Vergütungsverzeichnisses in der Anlage 1 zu § 2 Abs. 2 RVG (VV RVG).
Das im Musterfeststellungsverfahren erstinstanzlich zur Entscheidung berufene Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg hat festgestellt, dass die gegenüber Verbrauchern für die Beauftragung der Inkassodienstleisterin als Vergütung geltend gemachten Kosten keinen ersatzfähigen Verzugsschaden des beklagten Konzernunternehmen im Sinne der §§ 249 ff. BGB darstellen[1]. Ein Anspruch auf Erstattung der Inkassokosten, so das Hanseatische Oberlandesgericht, scheide vorliegend aus. Rechtsverfolgungskosten seien grundsätzlich nur dann zu ersetzen, wenn der Geschädigte im Innenverhältnis zu dem für ihn tätigen Rechtsdienstleister zur Zahlung der dem Schuldner in Rechnung gestellten Kosten verpflichtet sei. Das sei hier nicht der Fall, da es gemäß den zwischen dem beklagten Konzernunternehmen und der Inkassodienstleisterin getroffenen Abreden letztlich ausgeschlossen sei, dass das beklagte Konzernunternehmen die vereinbarte Inkassovergütung an die Inkassodienstleisterin zu bezahlen habe. Dies bedeute, dass der durch die Inkassodienstleisterin gegenüber den Verbrauchern konkret geltend gemachte Schaden bei dem beklagten Konzernunternehmen nicht entstanden sei. Denn es fehle an einer Vermögenseinbuße im Sinne der Differenzhypothese. Da sich das beklagte Konzernunternehmen der Belastung mit der (zugleich gestundeten) Vergütungsforderung durch die Erfüllungsabrede innerhalb derselben Vereinbarung wieder entledige, entstehe ihr in schadensrechtlicher Hinsicht kein Nachteil.
Der Bundesgerichtshof hat nun das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts aufgehoben und die Klage abgewiesen; die Musterfeststellungsklage sei nach § 606 ZPO aF zwar zulässig, jedoch nicht begründet:
Nach § 280 Abs. 1, 2, §§ 286, 249 Abs. 1 BGB sind dem Gläubiger grundsätzlich alle Einbußen zu ersetzen, die er durch die Verfolgung seiner Rechte gegen den bereits in Verzug geratenen Schuldner erleidet. Zu den danach erstattungsfähigen Rechtsverfolgungskosten zählen nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Ausgangspunkt auch diejenigen Aufwendungen, die dem Gläubiger dadurch entstehen, dass er – nach Verzugseintritt – ein Inkassounternehmen mit der Einziehung der Forderung beauftragt. Voraussetzung für die Erstattungsfähigkeit ist allerdings, dass die Rechtsverfolgungskosten aus Sicht des Geschädigten zur Wahrnehmung seiner Rechte erforderlich und zweckmäßig waren.
Entgegen der Auffassung des Hanseatischen Oberlandesgerichts handelt es sich danach bei der Inkassovergütung, deren Erstattung das beklagte Konzernunternehmen von den jeweiligen Schuldnern verlangt, um einen ersatzfähigen Verzugsschaden.
Bei dem für die Bestimmung eines Schadens vorzunehmenden Vergleich der infolge des haftungsbegründenden Ereignisses eingetretenen Vermögenslage mit derjenigen, die ohne jenes Ereignis eingetreten wäre (Differenzhypothese), begründet der Umstand, dass das beklagte Konzernunternehmen einem Vergütungsanspruch der Inkassodienstleisterin aus dem mit dieser geschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrag (§ 675 Abs. 1 iVm § 611 Abs. 1 BGB) ausgesetzt ist, einen Schaden. Zwar stellt die Belastung mit einer Verbindlichkeit nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nur dann und insoweit einen Schaden dar, als der Geschädigte mit der Verbindlichkeit tatsächlich beschwert ist. Eine solche Beschwer entfällt entgegen der Auffassung des Oberlandesgerichts aber nicht etwa dadurch, dass der Geschädigte mit dem Dritten, dessen Forderung den geltend gemachten Schaden bildet, besondere für den Geschädigten vorteilhafte Erfüllungsmodalitäten vereinbart. Dies gilt auch dann, wenn diese Modalitäten wie die Abrede, dass der Dritte hinsichtlich seiner Vergütung an Erfüllungs statt die Abtretung des diesbezüglichen Ersatzanspruchs des Geschädigten gegen den Schädiger annimmt zur Folge haben, dass der Geschädigte keinen direkten Mittelabfluss in Form einer Geldzahlung an den Dritten erleidet. Denn dies ändert nichts daran, dass der Geschädigte die Erfüllung der Forderung schuldet (§ 241 Abs. 1 BGB) und somit eine Vermögenseinbuße im schadensrechtlichen Sinne vorliegt.
So verhält es sich auch im Streitfall. Nach der hier getroffenen Abrede erfolgt die Erfüllung – wenn der Inkassodienstleisterin eine Realisierung der entsprechenden Ansprüche (Haupt- und/oder Nebenforderungen) gegenüber dem Schuldner (teilweise) gelingt – dadurch, dass die Inkassodienstleisterin berechtigt ist, den eingezogenen Betrag in Höhe der Vergütungsforderung zu behalten. Hierbei handelt es sich in dem Verhältnis zwischen dem beklagten Konzernunternehmen und der Inkassodienstleisterin um eine Leistung des beklagten Konzernunternehmens im Sinne von § 362 BGB, die letztlich darin besteht, dass das beklagte Konzernunternehmen auf die Geltendmachung ihres Anspruchs auf Auskehrung der durch die Geschäftsbesorgung erlangten Geldbeträge (§ 675 Abs. 1, § 667 BGB) insoweit verzichtet. Bleibt der Forderungseinzug hingegen erfolglos, erbringt das Konzernunternehmen die ihrerseits geschuldete Vergütungsleistung, indem sie ihren Schadensersatzanspruch gegen den jeweiligen Schuldner an die Inkassodienstleisterin an Erfüllungs Statt (§ 364 Abs. 1 BGB) abtritt.
Die Einschaltung der Inkassodienstleisterin war aus der insoweit maßgeblichen Sicht des beklagten Konzernunternehmens zur Wahrnehmung ihrer Rechte auch erforderlich und zweckmäßig. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Beauftragung eines Rechtsanwalts oder eines Inkassounternehmens regelmäßig selbst in einfach gelagerten Fällen aus der Sicht des Gläubigers erforderlich und zweckmäßig, wenn der Schuldner – wie in sämtlichen hier zu beurteilenden Fällen – in Zahlungsverzug geraten ist.
Der Umstand, dass der Forderungseinzug vorliegend im Wege eines Konzerninkassos betrieben wird, rechtfertigt es entgegen einer in der Literatur vereinzelt vertretenen Auffassung nicht, die Erforderlichkeit der hierdurch verursachten Kosten zu verneinen. Denn die Frage der Erstattungsfähigkeit von Inkassokosten richtet sich nicht nach der gewählten Organisation des Forderungsinkassos, sondern allein danach, mit welchen Tätigkeiten der Gläubiger das Inkassounternehmen beauftragt. Hat der Gläubiger der ihm obliegenden Mühewaltung – wozu beispielsweise die Stellung einer Rechnung oder die verzugsbegründende Erstmahnung zählen – genügt, wie regelmäßig anzunehmen ist, wenn er den Schuldner in Verzug gesetzt hat, und beauftragt anschließend – um seinem Erfüllungsverlangen Nachdruck zu verleihen – einen Rechtsanwalt oder ein (externes) Inkassounternehmen mit der Forderungseinziehung, besteht dem Grunde nach ein Anspruch auf Ersatz der hierdurch verursachten Kosten.
Im Fall der Beauftragung eines konzernverbundenen – gleichwohl aber rechtlich selbständigen – Inkassounternehmens kann nichts anderes gelten. Nur wenn im Einzelfall zusätzliche besondere Anhaltspunkte für ein von sachfremden Interessen geleitetes, rechtsmissbräuchliches Verhalten des Gläubigers – gegebenenfalls in kollusivem Zusammenwirken mit dem konzernverbundenen Inkassounternehmen – vorliegen, kann die Erforderlichkeit einer solchen Maßnahme zu verneinen sein. Solche Anhaltspunkte liegen hier jedoch nicht vor.
Auch der Umstand, dass durch ein konzernverbundenes Unternehmen erbrachte Inkassodienstleistungen vom Anwendungsbereich des Rechtsdienstleistungsgesetzes ausgenommen sind (§ 2 Abs. 1, 3 Nr. 6 RDG) und deshalb unter anderem die schuldnerschützende Vorschrift des § 4 Abs. 5 RDGEG aF (heute § 13e Abs. 1 RDG), wonach der Gläubiger von seinem Schuldner eine Erstattung von Inkassokosten nur bis zu der Höhe verlangen kann, die einem Rechtsanwalt für diese Tätigkeit nach den Vorschriften des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes zustehen würde, nicht (unmittelbar) anzuwenden ist, gebietet keine andere Beurteilung. Denn der vom Gesetzgeber mit jener Regelung bezweckte Schutz des Schuldners vor einer Belastung mit überhöhten Kosten lässt sich ohne weiteres dadurch erreichen, dass die in § 4 Abs. 5 RDGEG aF (heute § 13e Abs. 1 RDG) zum Ausdruck kommende gesetzgeberische Wertung, die als Konkretisierung der allgemeinen Schadensminderungsobliegenheit des Gläubigers nach § 254 Abs. 2 BGB zu begreifen ist, nach Maßgabe dieser letztgenannten Vorschrift auf die Erstattungsfähigkeit von Konzerninkassokosten übertragen wird. Da im Streitfall eine Berechnung der Inkassokosten gemäß dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vereinbart wurde, kommt eine Anspruchsminderung hiernach nicht in Betracht.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 19. Februar 2025 – VIII ZR 138/23
- OLG Hamburg, Urteil vom 15. Juni 2023 – 3 MK 1/21[↩]