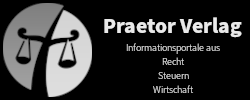Dieselskandal – und der Restschadensersatz in EU-Reimportfällen
Unter welchen Voraussetzungen besteht bei EU-Reimporten im sogenannten Dieselskandal ein Restschadensersatz? Mit dieser Frage hatte sich aktuell der Bundesgerichtshof zu befassen:
Dem zugrunde lag ein Fall aus Schwaben: Der Autokäufer nimmt die beklagte Fahrzeugherstellerin wegen der Verwendung einer unzulässigen Abschalteinrichtung auf Schadensersatz in Anspruch. Er bestellte am 13.08.2014 bei einem deutschen Händler als EU-Reimport einen Neuwagen des Typs VW Tiguan zum Preis von 30.000 €. Das Fahrzeug wurde dem Autokäufer am 25.10.2014 mit einer EGÜbereinstimmungsbescheinigung und einer Laufleistung von 0 km übergeben. Der deutsche Händler hatte das Fahrzeug zuvor von einem Händler in einem anderen EU-Mitgliedstaat erhalten, der es von der Volkswagen AG erworben hatte. Die Volkswagen AG ist Herstellerin des Fahrzeugs und des darin verbauten Dieselmotors der Baureihe EA 189. Der Motor war mit einer Software ausgestattet, die hinsichtlich der Abgasrückführung zwischen Prüfstand und gewöhnlichem Fahrbetrieb unterschied, sodass die Emissionsgrenzwerte für Stickoxide nur auf dem Prüfstand eingehalten wurden. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) beanstandete die Software im Jahr 2015. Die Volkswagen AG entwickelte ein Software-Update, das vom KBA zugelassen wurde. Die Volkswagen AG informierte den Autokäufer im Februar 2016 über die Betroffenheit seines Fahrzeugs vom sogenannten Dieselskandal. Im November 2016 ließ der Autokäufer das Software-Update aufspielen.
Der Autokäufer hat in erster Instanz beantragt, die Volkswagen AG zur Zahlung von 30.000 € nebst Zinsen abzüglich einer Nutzungsentschädigung Zug um Zug gegen Rückgabe und Übereignung des Fahrzeugs sowie zur Erstattung von vorgerichtlichen Rechtsverfolgungskosten zu verurteilen und den Annahmeverzug der Volkswagen AG festzustellen. Das Landgericht Ravensburg hat die Klage abgewiesen[1]. Auf die Berufung des Autokäufers, mit der er die Höhe der anzurechnenden Nutzungsentschädigung etwas reduziert und hilfsweise beantragt hat, die Volkswagen AG zur Zahlung von 7.500 € ohne Zugum-Zug-Vorbehalt zu verurteilen, hat das Oberlandesgericht Stuttgart die Volkswagen AG unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels gemäß dem Hilfsantrag ohne Zugum-Zug-Vorbehalt verurteilt, 2.250 € an den Autokäufer zu zahlen[2]. Dabei hat das Oberlandesgericht Stuttgart angenommen, die Volkswagen AG sei dem Grunde nach gemäß §§ 826, 31 BGB zum Schadensersatz in Form der Rückgängigmachung des Kaufvertrags über das Fahrzeug verpflichtet. Dieser Anspruch sei jedoch verjährt. Die Volkswagen AG habe allerdings gemäß §§ 826, 852 Satz 1 BGB den auf Kosten des Autokäufers erlangten Kaufpreis herauszugeben, soweit er ihr nach Abzug der Herstellungskosten und der Händlermarge verblieben sei. Dass der Autokäufer das Fahrzeug nicht direkt von der Volkswagen AG, sondern über einen Händler als reimportierten EU-Neuwagen erworben habe, schließe die Anwendung des § 852 Satz 1 BGB nicht aus. Auch wenn die Volkswagen AG das Neufahrzeug zunächst in das EU-Ausland verkauft und den Kaufpreis unmittelbar von dem erwerbenden Händler erhalten habe, habe sie ihn doch bei wirtschaftlicher Betrachtung nicht auf dessen Kosten, sondern auf Kosten des Autokäufers erlangt.
Die vom Oberlandesgericht Stuttgart zugelassene Revision der Volkswagen AG, mit der sie ihren Antrag auf Zurückweisung der Berufung des Autokäufers weiterverfolgt hat, hatte nun vor dem Bundesgerichtshof ebenso Erfolg wie die Anschlussrevision des Autokäufers, mit der er seine Berufungsanträge teilweise weiter geltend gemacht hat. Revision und Anschlussrevision führten im Umfang des Angriffs der Parteien in der Revisionsinstanz zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Oberlandesgericht Stuttgart:
Dabei hielt die Annahme des Oberlandesgerichts Stuttgart, der Anspruch aus §§ 826, 31 BGB sei verjährt, einer revisionsrechtlichen Überprüfung stand. Die vom Oberlandesgericht Stuttgart getroffenen Feststellungen reichten aber nicht aus, um einen Anspruch des Autokäufers aus §§ 826, 852 Satz 1 BGB zu bejahen.
Wie der Bundesgerichtshof nach Erlass des Berufungsurteils für den Erwerb von Neuwagen über einen Händler ohne Bezug zum EU-Ausland bereits entschieden hat[3], hängt die Frage, ob der Erwerber nach Verjährung des Anspruchs aus §§ 826, 31 BGB einen Anspruch aus § 852 Satz 1 BGB geltend machen kann, von den vom Tatrichter festzustellenden Umständen des Einzelfalls ab. Liegt danach dem Neuwagenkauf eines nach § 826 BGB durch den Fahrzeughersteller Geschädigten bei einem Händler die Bestellung des bereitzustellenden Fahrzeugs durch den Händler bei dem Fahrzeughersteller zugrunde und schließen der Fahrzeughersteller und der Händler einen Kaufvertrag über das Fahrzeug, aufgrund dessen der Fahrzeughersteller gegen den Händler einen Anspruch auf Zahlung des Händlereinkaufspreises erlangt, ist dem Grunde nach ein Anspruch aus §§ 826, 852 Satz 1 BGB gegeben, weil der schadensauslösende Vertragsschluss zwischen dem Geschädigten und dem Händler einerseits und der Erwerb des Anspruchs auf Zahlung des Händlereinkaufspreises bzw. der Erwerb des Händlereinkaufspreises durch den Fahrzeughersteller andererseits auf derselben, wenn auch mittelbaren Vermögensverschiebung beruhen. Hat der Händler dagegen das streitgegenständliche Fahrzeug unabhängig von einer Bestellung des Geschädigten vor dem Weiterverkauf auf eigene Kosten und eigenes Absatzrisiko erworben, fehlt es an dem für §§ 826, 852 Satz 1 BGB erforderlichen Zurechnungszusammenhang. Nach Verjährung des Anspruchs aus §§ 826, 31 BGB besteht dann auch kein Anspruch aus §§ 826, 852 Satz 1 BGB.
Mit der aktuellen Entscheidung hat der Bundesgerichtshof nunmehr klargestellt, dass diese Grundsätze auch für den Erwerb im Wege des EU-Reimports gelten. Die Beteiligung eines weiteren, im EU-Ausland ansässigen Zwischenhändlers neben dem inländischen Händler und Verkäufer schließt eine Vermögensverschiebung vom geschädigten Erwerber zum Hersteller eines vom sogenannten Abgasskandal betroffenen Dieselfahrzeugs im Sinne von §§ 826, 852 Satz 1 BGB nicht aus. Erforderlich ist jedoch auch hier, dass der Fahrzeugerwerb durch den geschädigten Erwerber zu einem korrespondierenden Vermögenszuwachs beim Hersteller geführt hat. Das ist nur dann der Fall, wenn weder der inländische Händler noch der ausländische Zwischenhändler das Fahrzeug zuvor unabhängig von der Bestellung des Geschädigten auf eigene Kosten und eigenes Absatzrisiko erworben haben.
Das Oberlandesgericht Stuttgart wird nach Zurückverweisung der Sache Gelegenheit haben, zu dieser entscheidungsrelevanten Frage weitere Feststellungen zu treffen. Sollte es zu dem Ergebnis gelangen, dem Autokäufer stehe dem Grunde nach ein Anspruch aus §§ 826, 852 Satz 1 BGB zu, wird es bei der Bemessung der Höhe des Anspruchs die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs[4] zu beachten haben.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 13. Juni 2022 – VIa ZR 680/21
- LG Ravensburg, Urteil vom 13.04.2021 – 4 O 379/20[↩]
- OLG Stuttgart, Urteil vom 18.11.2021 – 14 U 58/21[↩]
- BGH, Urteil vom 21.03.2022 – VIa ZR 275/21, WM 2022, 745[↩]
- BGH, Urteile vom 21.02.2022 – VIa ZR 8/21, WM 2022, 731; und VIa ZR 57/21, WM 2022, 742[↩]