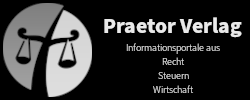Zeugen Jehovas und die Haftung für den örtlichen Königreichssaal
Die kirchengesetzlichen Regelungen von „Jehovas Zeugen in Deutschland KdöR“ über die Eingliederung der örtlichen Vereine in die öffentlich-rechtliche Körperschaft sind nach Ansicht des Bundesgerichtshofs unwirksam.
In dem jetzt vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall verletzte sich im Oktober 2003 die Versicherungsnehmerin der Klägerin in dem damals im Eigentum des Beklagten stehenden „Königreichssaal“ schwer. Die Klägerin verlangt deshalb von ihm aus übergegangenem Recht Schadensersatz wegen einer Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.
Der Beklagte ist eine örtliche Untergliederung des deutschen Zweigs der Glaubensgemeinschaft Jehovas Zeugen. Der deutsche Zweig der Glaubensgemeinschaft war ursprünglich als „Jehovas Zeugen in Deutschland e.V.“ organisiert, der Beklagte als „Jehovas Zeugen, Versammlung Ö. e.V.“. Am 13. Juni 2006 wurden dem Verein „Jehovas Zeugen in Deutschland e.V.“ vom Land Berlin die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts verliehen. Diese nunmehr öffentlich-rechtliche Körperschaft erließ am 8. Juli 2006 ein Übergangsgesetz, in dem geregelt ist, dass die bestehenden Versammlungen mit der Verleihung der Körperschaftsrechte religionsrechtlich selbständige Untergliederungen des öffentlichen Rechts sind, deren Eigentum ihnen zugeordnet bleibt und von ihnen verwaltet wird. Später stellte sie in § 5 Abs. 4 Statusrechtsgesetz in der Fassung vom 27. Mai 2009 klar, dass die religionsrechtlich selbständigen Gliederungen grundsätzlich nicht über eine eigene Rechtspersönlichkeit im staatlichen Recht verfügen. Am 12. Dezember 2007 löschte das Amtsgericht den Beklagten aus dem Vereinsregister.
Im Dezember 2010 hat die Klägerin gegen den Verein „Jehovas Zeugen, Versammlung Ö. e.V.“ Klage erhoben. Die Klage war erstinstanzlich vor dem Landgericht Heilbronn erfolgreich[1]. Dagegen hat auf die Berufung des Beklagten das Oberlandesgericht Stuttgart das Urteil des Landgerichts Heilbronn aufgehoben und die Klage als unzulässig abgewiesen, da der beklagte Verein im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht mehr existiert habe[2]. Die hiergegen gerichtete Revision der Klägerin hatte vor dem Bundesgerichtshof Erfolg:
Der Bundesgerichtshof beurteilte den beklagten Verein als rechtlich noch existent, so dass er auch verklagt werden kann. Das von der Körperschaft des öffentlichen Rechts „Jehovas Zeugen in Deutschland“ erlassene Kirchengesetz hat mangels hinreichender Klarheit dessen rechtliche Existenz nicht beendet.
Zwar kann eine Religionsgemeinschaft, die den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts erlangt hat, in Ausübung ihres Selbstbestimmungsrechts (Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 WRV) in ihrer Gründungsphase durch Kirchengesetz einen zu der Gemeinschaft gehörenden privatrechtlich organisierten Verein in die Körperschaft eingliedern und damit dessen eigenständige rechtliche Existenz beenden. Dies erfordert jedoch ein – im Amtsblatt der Religionsgemeinschaft zu veröffentlichendes – hinreichend klares Gesetz der Körperschaft, in welchem Gesamtrechtsnachfolge angeordnet, der einzugliedernde Verein benannt und der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Eingliederung eindeutig geregelt ist. Zudem muss sich der Verein der Regelungsbefugnis der Religionsgemeinschaft hinsichtlich einer Eingliederung und einer damit verbundenen Vermögensübertragung unterworfen haben.
Das von der Körperschaft des öffentlichen Rechts „Jehovas Zeugen in Deutschland“ erlassene Gesetz genügt diesen Anforderungen nicht, insbesondere fehlt es an der erforderlichen Klarheit der Regelungen. Diesen lässt sich nicht hinreichend deutlich entnehmen, dass die Körperschaft Gesamtrechtsnachfolgerin des Vereines sein soll. Die eigenständige rechtliche Existenz des Beklagten ist daher nicht beendet.
Der Bundesgerichtshof hat daher die Sache an das Oberlandesgericht Stuttgart zurückverwiesen, damit dort über die Berechtigung der von der Klägerin geltend gemachten Schadensersatzansprüche entschieden wird.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 15. März 2013 – V ZR 156/12
- LG Heilbronn, Urteil vom 17.05.2011 – 1 O 181/10[↩]
- OLG Stuttgart, Urteil vom 15.02.2012 – 3 U 115/11[↩]