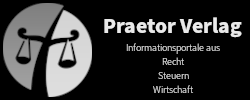Der Kauf eines Eigenheims – und die nicht hälftig geteilten Maklerkosten
Der Bundesgerichtshof hatte aktuell über die Voraussetzungen eines Verstoßes gegen den in § 656c Abs. 1 Satz 1 BGB vorgesehenen Grundsatz der hälftigen Teilung der Maklercourtage für den Fall zu entscheiden, dass der Makler sowohl für den Verkäufer als auch für den als Verbraucher handelnden Käufer eines Einfamilienhauses tätig wird.
Dem zugrunde lag ein Fall aus Düsseldorf. Die Maklerin unterzeichneten eine Courtagevereinbarung mit der Maklerin. Auf Nachweis durch die Maklerin erwarben die Immobilienkäufer eine Immobilie, die mit einem Einfamilienhaus nebst Anbau mit Büro und Garage bebaut ist. Die Maklerin war von der Ehefrau des Eigentümers mit der Vermarktung der Immobilie beauftragt worden. Dabei war eine Provision vereinbart worden, die von der mit den Immobilienkäufer vereinbarten Provision abweicht.
Das erstinstanzlich hiermit befasste Landgericht Düsseldorf hat die Klage auf Zahlung der Maklerprovision abgewiesen[1]. Die dagegen gerichtete Berufung der Maklerin hat das Oberlandesgericht Düsseldorf zurückgewiesen[2]; der Provisionsanspruch sei unbegründet, weil der Vertrag wegen Verstoßes gegen § 656c BGB unwirksam sei. Die hiergegen gerichtete Revision der Maklerin hatte vor dem Bundesgerichtshof keinen Erfolg, der Bundesgerichtshof wies sie als unbegründet ab:
Das Berufungsgericht hat den Maklervertrag zu Recht als gemäß § 656c Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 BGB unwirksam angesehen, weil die Maklerin sich nicht von der Ehefrau des Verkäufers und den als Verbraucher handelnden Käufern eine Provision in gleicher Höhe hat versprechen lassen.
Um ein Einfamilienhaus im Sinne der §§ 656a ff. BGB handelt es sich, wenn der Erwerb des nachzuweisenden oder zu vermittelnden Objekts für den Makler bei Abschluss des Maklervertrags mit dem als Verbraucher handelnden Erwerber erkennbar Wohnzwecken der Mitglieder eines einzelnen Haushalts dient. Der Wohnzweck ergibt sich im Streitfall aus dem vom Berufungsgericht rechtsfehlerfrei gewürdigten Gesamteindruck. Der Annahme, dass das Einfamilienhaus Wohnzwecken dient, steht nicht entgegen, dass darin eine Einliegerwohnung oder eine anderweitige gewerbliche Nutzungsmöglichkeit von jeweils nur untergeordneter Bedeutung (hier: ein 1/5 der Gesamtfläche umfassender Büroanbau) vorhanden ist.
Der Anwendung des § 656c BGB steht weiter nicht entgegen, dass im Streitfall nicht der Verkäufer, sondern seine Ehefrau den Makler beauftragt hat. Zwar regelt § 656c Abs. 1 BGB lediglich den Fall des Abschlusses eines Maklervertrags zwischen dem Makler und jeweils den Parteien des Kaufvertrags, nicht jedoch den Abschluss des Maklervertrags mit einem Dritten anstelle einer Partei des Kaufvertrags. Diese Vorschrift ist jedoch entsprechend anzuwenden, wenn anstelle einer Kaufvertragspartei ein Dritter den Maklervertrag abschließt. Der Zweck des § 656c BGB, Verbraucher davor zu schützen, dass Maklerkosten unter Ausnutzung ihrer aufgrund der Marktsituation geschwächten Verhandlungsposition in unbilliger Weise auf sie abgewälzt werden, ist unabhängig davon berührt, ob der Maklervertrag mit einer Kaufvertragspartei oder einem Dritten geschlossen wird. Es erweist sich als planwidrige Regelungslücke, dass die Vorschrift des § 656c BGB den Abschluss des Maklervertrags durch einen Dritten anstelle einer Partei des Hauptvertrags nicht erfasst.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 6. März 2025 – I ZR 32/24
- LG Düsseldorf, Urteil vom 27.09.2022 – 11 O 44/22[↩]
- OLG Düsseldorf, Urteil vom 26.01.2024 – 7 U 243/22[↩]